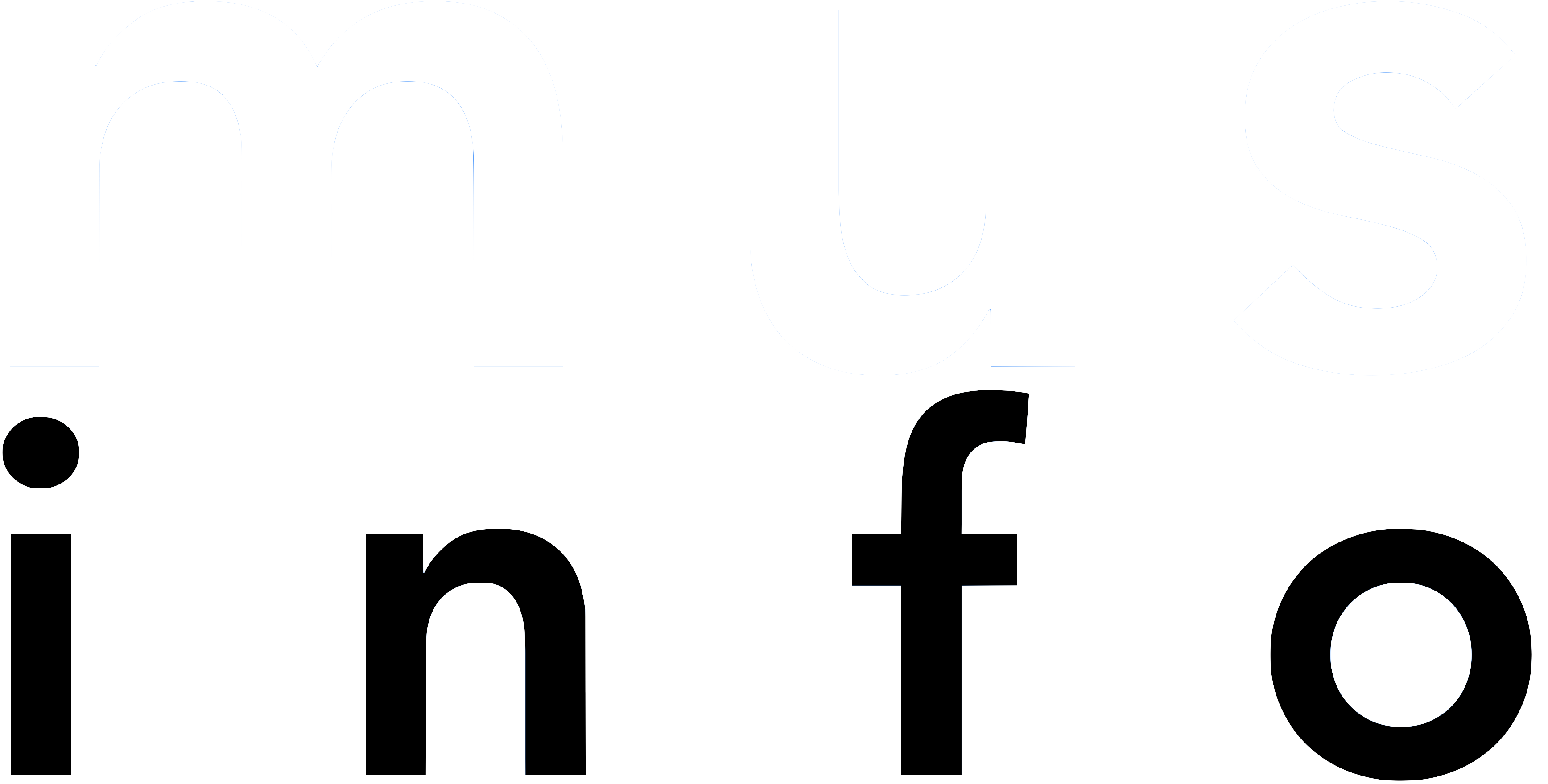Don' be Afraid of Colours
Ein Gespräch in E-Mails mit Dieter Ammann
Dieter Ammann, Schüler von Roland Moser und Detlev Müller-Siemens, gehört zu den herausragendsten Gestalten in der eidgenössischen Musikszene. Als Trompeter, Keyboarder und E-Bassist spielt der im Jahr 1962 geborene Zofinger seit vielen Jahren in der Freefunk-Band Donkey Kong’s Multiscream. Er arbeitete mit so unterschiedlichen Übervätern wie Peter Brötzmann und Udo Lindenberg zusammen und komponiert pro Jahr etwa ein Werk. Ammann unterrichtet Komposition und Musiktheorie an der Musikhochschule Luzern. Kürzlich gelangte sein neues Werk pRESTO sOSTINATO im Rahmen der Feierlichkeiten zu Paul Sachers 100. Geburtstag zur Uraufführung.
Dissonanz: Dieter Ammann, was war Dein letzter musikalischer Gedanke?
Dieter Ammann: Da muss man unterscheiden: Bezüglich meiner nächsten Komposition [pRESTO sOSTINATO für grosses Ensemble] drehe und wende ich momentan gedanklich zwei Viertongruppen herum, dehne, komprimiere die Töne, transponiere sie, stelle sie mir vertikal (akkordisch) vor – kurz: ich versuche, mir klangliches Material anzueignen bis zu einem möglichst hohen Grad der Verinnerlichung – auch gefühlsmässig. Ansonsten habe ich ziemlich anders geartete Musik im Kopf; das kann eine Improvisation über ein Bluesschema oder eine barocke Quintfallsequenz sein – jedenfalls alles Musik, die aus dem Stegreif innerlich vorstellbar ist, und meist nicht viel «Konstruiertes» in sich trägt. Es würde mich sowieso einmal interessieren, ob es Komponisten gibt, die «unter der Dusche» in derselben Tonsprache singen oder pfeifen, in der sie komponieren.
Mauricio Kagel behauptete einmal, seine Kollegen würden in der «Freizeit» ausschliesslich tonale Musik hören (wobei offen bleibt, wie es sich bei ihm selber verhält). Gibt es bei Dir eine solche Unterscheidung zwischen «berufsmässiger» Musik (z.B. die von Dir erfundene) und «Freizeit»-Musik? In welcher Tonsprache singst und pfeifst Du «unter der Dusche»?
Ja, diese Unterscheidung gibt es durchaus. Wenn ich an der Sonne sitze, am Grill oder unter der Dusche stehe, gehen mir Melodien und/oder Grooves durch den Kopf, die einem «einfach so» zuströmen, also ohne strukturelle Vorarbeit. Beim Musikhören mache ich keine Unterschiede zwischen «Freizeit- und Berufsmusik». Dies ist vielmehr stimmungsabhängig. Ich finde, dass Neue Musik auch aus einem primär emotionalen Hörverständnis heraus erlebbar ist, frei nach dem Motto: wie «fährt mir das ein», was ich höre? Dies ist eine Fragestellung, die mich auch beim eigenen Komponieren beschäftigt. Sicher ist jedoch, dass ich einen Popsong nicht analytisch höre – das wäre meist nicht sehr ergiebig …
Kürzlich las ich von einem deutschen Musikwissenschaftler, der die Meinung vertritt, es sei im Zuge der Demokratisierung der westlichen Gesellschaften bis in die untersten Schichten hinein nur folgerichtig gewesen, dass das Publikum den Schritt zur Atonalität verweigert hätte. Indirekt spricht er damit der zeitgenössischen komponierten Musik die Existenzberechtigung als Ausdrucksform einer (zugegebenermassen Hoch-)Kultur ab. Ein Schwachsinn sondergleichen, der aber irgendwie auch wieder symptomatisch ist für die (kulturelle) Befindlichkeit grosser Teile unserer Gesellschaft.
Es erstaunt mich, das Klischee der Unanalysierbarkeit von Popmusik von Dir, einem als Trompeter und Keyboarder der Freefunk-Band Donkey Kong’s Multiscream sehr erfahrenen Musiker auch auf diesem Gebiet, zu hören. Inwiefern ist «Analysierbarkeit» ein ästhetisches Kriterium?
Mir fällt ein Konzertbesuch ein, bei dem ich mich über ein uraufgeführtes Stück meinem Sitznachbarn (ein Musiker) gegenüber sehr positiv äusserte. Seine Antwort darauf war, er könne dazu nichts sagen, ohne das Stück analysiert (!) zu haben. Dabei hatte er doch auch zwei Ohren am Kopf! Wenn nicht im Klanglichen, woher rührt dann die Legitimation, musikalische Vorgänge schriftlich zu fixieren, und sie so der Wiederholbarkeit auszusetzen? Ich denke schon, dass durchdachte Materialbehandlung (z. B. Vor- und Rückbezüge, Variantbildungen, Ableitungen etc.) eine gewisse Komplexität bezüglich Binnenstruktur und Grossform, bewusste Gestaltung des dramaturgischen Verlaufs und ähnliches unabdingbare Merkmale von komponierter Musik sein müssten; vieles davon liesse sich folgerichtig auf analytischem Weg nachweisen. Aber die Analysierbarkeit zum ästhetischen Kriterium zu erheben zielt meiner Meinung nach an der Sache – der Musik – vorbei. Denn Musik ist für mich als Hörer eben das, was ich höre – und dies muss sich in keiner Weise mit strukturellen Gegebenheiten decken.
Nochmals zum «musikalischen Gedanken» bzw. «Musik in Kopf»: Muss ein musikalischer Gedanke immer in real erklingenden Tönen darstellbar sein?
Nein. Oftmals ist eine «Idee» zu Beginn noch völlig abgekoppelt von realen Tonhöhenverläufen oder Rhythmen. Bei mir sind gedankliche Ausgangspunkte bisweilen räumlicher oder kinetischer Natur, also Vorstellungen von Zuständen oder Prozessen, wie sie ausserhalb des Musikalischen/Klanglichen ebensogut (oder noch besser) denkbar sind. Ich stelle sogar fest, dass bei der Gestaltwerdung innerer Vorstellungen (Visionen?) durch den Akt des Notierens eine Art Einschränkung oder Begrenztheit wirksam wird, welche so stark werden kann, dass das klangliche Resultat mit der Ursprungsidee nicht mehr viel gemeinsam hat. Dies ist manchmal zwar ernüchternd, zwingt einen aber, diese Ursprungsidee immer wieder auf ihre musikalische Tauglichkeit hin zu überprüfen und sie gegebenenfalls zu modifizieren oder gänzlich von ihr abzurücken. Das Klangresultat ist demzufolge – im Idealfall! – nur eine von vielen denkbaren Realisierungen solcher aussermusikalischen Vorstellungen, eine von vielen möglichen Lösungen der Darstellbarkeit. Solche (ausser)musikalische Vorstellungen versuche ich oft verbal oder graphisch zu skizzieren. Verbal z.B. so: die Form eines Trichters darstellen; eine gerichtete kinetische Bewegung zu verdichten und sie – quasi auf ihrem Höhepunkt – in ein «Auf-der-Stelle-Treten» umschlagen zu lassen; energetische Verläufe, z.B. eine Erosion, ein Zerfall, darstellen usw. Erinnert sei an die aussermusikalischen, autonomen Bedeutungen der jeweils zweiten Worthälften von Begriffen wie Klang-farbe, Klang-rede, Klang-raum. Klänge können verebben, brüchig werden, sich ballen und vieles mehr. Bei einem Stück wie Ligetis Atmosphères wird meiner Meinung nach ersichtlich, wie eine «Utopie» mittels musikalischer Gestaltung zu Klang geworden ist.
Eine «Utopie» in besonderem Sinn: György Ligeti hat in «Apparitions» und «Atmosphères» Vorstellungen realisiert, die er bereits im stalinistischen Ungarn entwickelt hatte und geheim halten musste, um überleben zu können … Komponieren bedeutet Dir also, eine «Vorstellung» im Medium des musikalischen Klangs zu realisieren (die Destruktion der «Vorstellung» ist dabei offenbar eine Option). Ich nehme an, das entspricht dem Konzept der «Gehörten Form», nach dem Du Dein Streichtrio von 1998 benannt hast. Neben kinetischen und räumlichen Fragen scheint der Sprachcharakter von Musik Dir wichtig zu sein. Nach einem früheren Stück heisst Deine neue Platte «The Freedom of Speech» hat[now]ART 158: Was ist damit gemeint?
Ja, die Detonation der ursprünglichen Vorstellung ist eine Option, aber nicht unbedingt eine erstrebenswerte. Manchmal passiert das einfach beim Versuch der Transformation in Klang. Dies kann verschiedene Gründe haben: vielleicht ist die Grundidee ihrem Wesen nach zu «musikfern», oder aber ich muss mich der Begrenztheit der eigenen Fähigkeit, die Vorstellung zu notieren, beugen. Während Letzteres natürlich unbefriedigend ist, kann im ersten Fall bisweilen etwas wirklich Neues entstehen, was zu Beginn nicht intendiert war. Dies wiederum wirkt sich dann auf die Formwerdung des Stücks aus, umso mehr, da ich wenig mit Hilfe von prädeterminierten Verfahren komponiere.
Zum Sprachcharakter: Es gab und gibt ja die Methode, sprachähnliche rhythmische «Modelle» zu bilden, die dann den linearen, melodischen Verläufen ihr Gepräge geben. Bei mir findet sich Sprachähnlichkeit eher in der diskursiven Beziehung zwischen mehreren Instrumenten, und zwar in einem theatralisch-dramaturgischen Sinn; so wird beispielsweise eine Stimme in ihrem Monolog mehrfach durch ein anderes musikalisches Geschehen gestört, was dann Reaktion auslösen kann wie Insistieren auf dem Gesagten, Irritation des Monologs oder Annäherung an den Gegenpart. Das Stück für Violoncello und Ensemble Violation wäre so ein Beispiel. Aber dieses vernetzte Reagieren spielt sich auch auf engstem Raum ab, bisweilen in Sekundenbruchteilen oder auch innerhalb nur einer Stimme – das ist für mich ein wichtiger Aspekt in der komponierten Musik überhaupt, die Planbarkeit des Beziehungsnetzes auf den verschiedenen Ebenen. Der Titel The Freedom of Speech wiederum hat zwei Bedeutungen: Zum Einen war dies das erste Stück, das aus einem kurzen, «spontanen» Anfangsgestus heraus geformt wurde. Zudem habe ich für mich damals neuartige Satztechniken und Ordnungen (welche bis zu semi-improvisierten Passagen reichen) ausprobiert und ziemlich zwanglos aneinander gereiht (das habe ich in späteren Arbeiten nicht mehr zugelassen). Zum Zweiten dachte ich dabei an meinen Vater, der während der Arbeit an diesem Stück unerwartet verstarb. Er war ein sehr freundlicher Mensch, der sich aber nicht scheute, seine Meinung klar kund zu tun.
Wieso hast Du nach «The Freedom of Speech» Aleatorik aus Deiner Musik verbannt?
Weil aleatorische Verfahren nichts als eine Verschiebung der Verantwortung vom Komponisten zum Interpreten bedeutet! Ein Beispiel: Momentan skizziere ich melodische Linien, in denen eine nach bestimmten Kriterien transponierte Siebentongruppe an acht rhythmische Werte gekoppelt wird. Ein einfaches, uraltes Prinzip also, aber strukturell trotzdem nie zu erreichen mittels aleatorischen oder improvisatorischen Lenkungsvorgaben. Für The Freedom of Speech musste ich übrigens kurz vor der Uraufführung auf Wunsch der Musiker quasi über Nacht eine der aleatorischen Stellen auskomponieren, was in der kurzen Zeit mehr schlecht als recht gelang; trotzdem wird diese Version auch heute noch gespielt. Heute verwende ich allenfalls noch den (Lutoslawskischen) «aleatorischen Kontrapunkt», in dem durch die Preisgabe der exakten Kontrolle der Vertikalen im Gegenzug mikro-rhythmische Texturen gewonnen werden, wie sie schwerlich mittels traditioneller Notation zu erreichen wären. Die Kategorie des geschlossenen Werks ist halt integraler Bestandteil meines kompositorischen Denkens.
Und nicht nur die Kategorie des «geschlossenen Werks»: In Deiner (komponierten) Musik stellst Du weder das herkömmliche Instrumentarium, noch das Konzertritual in Frage, auch verwendest Du keine neuen Medien und sprichst von «Viertongruppen», «Intervallkonstellationen», «Binnenstruktur» und «Grossform». Wie kommt es, dass Du Dich zur Realisierung musikalischer Vorstellungen ausschliesslich erprobter Mittel bedienst? Bist Du ein altmodischer Komponist?
Altmodisch zu sein würde implizieren, zu wissen, was neumodisch ist. Ich weiss es nicht. Eine Komposition für herkömmliches Instrumentarium ist für mich einfach eine unter vielen Disziplinen, wie beispielsweise elektronische Musik oder Computermusik. Von den äusseren Mitteln her ist natürlich ein Stück für Violoncello einer älteren Gattung zugehörig als ein Stück für computergesteuerten Sequenzer. Aber das lässt keine Rückschlüsse auf die Qualität von Musik zu. Ich realisiere also meine Vorstellungen in der Disziplin «traditionelles Instrumentarium». Und dann geht es mir eben genau in dieser Disziplin darum, etwas möglichst Eigenständiges zu schaffen, was mir beispielsweise im Formalen bisweilen gelingt. Ich erinnere mich noch an die Irritation von Paul Sacher, der bei einem meiner Stücke bemerkte, er finde «wenig Halt», was vermutlich mit dem von Dir einst konstruierten «konstruktiven Verirren innerhalb einer oft kleingliedrigen Form» zusammen hängt. Zum gängigen Konzertritual: Auch heute macht es noch Sinn, Zeitgenössisches gerade im völlig mit Tradition beladenen Kontext eines Konzerts zu präsentieren, weil da auch Leute sitzen, die nicht an der neusten Multimediaperformance anzutreffen sind. Das ist eine der Aufgaben, die die «Darreichungsform Konzert» auch heute noch hat, ganz abgesehen vom – vielleicht altmodischen! – didaktischen Aspekt: Im mono-medialen Konzerterlebnis wird der Hörer aufgefordert, sich mal wieder auf eine einzige Sache zu konzentrieren, eben auf das Hören. Musik, welche für das Konzert bestimmt ist, muss dann auch «per se» genügen können.
Betrachtest Du eine musikalische Form als gelungen, wenn der Hörer «keinen Halt» mehr findet? Ist das die Kehrseite zur konventionellen Erscheinungsform Deiner komponierten Musik? Anders gefragt: Rekurrierst Du auf musikalische Konventionen, um Deine Hörer gezielt zu täuschen?
«DEN HÖRER» GIBT ES NICHT! Ich denke, dass die Anzahl der Meinungen über Musik mit der Anzahl Hörer übereinstimmt, jedenfalls, was die Nuancen in der Meinungsbildung betrifft. Es kann daher kein Ziel sein, «dem Hörer» den Halt zu entziehen, und dies vor allem auch deshalb, da jegliche Art von Musik (oder Kunst generell) nur dann Sinn macht, wenn sie fähig ist, mit ihrer Umgebung in einen Dialog zu treten, also eine kommunikative Seite hat. Solche Überlegungen spielen allerdings beim Komponieren keine Rolle. Da wäre ja das Pferd am Schwanz aufgezäumt. Dazu müsste man die Musik quasi als Objekt von aussen her betrachten und ganz nüchtern kalkulieren, was, wie, wann beim Rezipienten (bei welchem eigentlich?) welchen Effekt erzeugt. Ich schreibe nur auf, was meiner (subjektiven) Kritik standhält, und da kann es vorkommen, dass ich den Notentext auch vom Blickwinkel des Hörers (ich, als Subjekt!) auf seine Substanz hin befrage. Oftmals herrscht ja in Musik – auch in der neuen Musik – über längere Strecken eine «Einheitlichkeit des Affekts». Selbst die Schablone schnell-langsam-schnell, sogar in einzelne Sätze gegliedert, wird auf grossformaler Ebene bedenkenlos «angewendet». Eine Eigenheit meiner Musik besteht darin, dass diese auf engstem Raum grosse Kontraste auszuhalten fähig sein muss. Diese Komprimierung verschiedenartiger Charakteristika kann für den Hörer durchaus eine Herausforderung darstellen, wie übrigens ein Stück von Morton Feldman eine vermutlich noch grössere Herausforderung sein kann, mit umgekehrten Vorzeichen. Was ist also eine «konventionelle Erscheinungsform»? Ist es möglich, den Begriff der Konvention allgemeingültig zu definieren? Ist es nicht so, dass des Einen Konvention des Anderen Neuland bedeuten kann?
Gewiss. Es geht freilich weniger um statistisch untermauerbare Allgemeingültigkeiten (wenn mindestens x % der «Hörer» auf y mit z reagieren, kann von «Konvention» gesprochen werden) als eher um einen bewussten Umgang mit musikalischen Konventionen (die es ja gibt, ich setze jetzt einen gewissen kulturellen Standard voraus). Aber lass uns empirisch werden: Welche Reaktion eines Hörers beim Hören Deiner (komponierten) Musik hat Dich am meisten überrascht?
Manchmal bin ich wirklich überrascht ob der unterschiedlichen Rückmeldungen. Bisweilen wird gesagt, die Musik würde einen auf einer fast haptisch-physischen Ebene «packen» oder gar «anspringen»; einmal hörte ich von jemandem, die Klänge hätten den Rhythmus seines Atems beeinflusst. Oftmals wird von inneren Bildern, einem imaginären Film und ähnlich Assoziativem erzählt (z.B. in Musikkritiken). Interessant daran ist die Tatsache, dass diese «Bilder» dermassen verschieden sind, obwohl sie ja durch dasselbe akustische Erlebnis evoziert werden. Das Spektrum reicht von (eher nahe liegenden) nicht-figürlichen Farbspektren und Formenmustern über Landschaftsbilder (!) bis hin zu Naturereignissen wie Sturm oder Feuer. Da ich beim Komponieren nie solche aussermusikalischen Assoziationen, geschweige denn «Inspirationen» habe, scheint es sich dabei um eine reine «Eigenleistung» des Hörers zu handeln.
In letzter Zeit habe ich immer mehr Mühe mit zeitgenössischen Werken, die keine harmonischen Gefälle haben – und davon gibt es nicht wenige. Es ist natürlich bequem, das Tonmaterial dermassen zu organisieren, dass in der Vertikale immer etwa derselbe klangliche Sättigungsgrad vorherrscht. Ich finde es als Hörer aber sehr oft einfach nur noch langweilig, vor allem dann, wenn sich die Musik gestisch enorm exaltiert gibt. Dann empfinde ich die Monochromie solcher Harmonik als unbotmässige Diskrepanz zu der gestischen (Pseudo-)Expressivität.
Eigentlich bist Du Jazzer und Improvisator. Wie bist Du zum Komponieren gekommen? Was hat sich beim Improvisieren verändert, seit Du Musik schreibst?
Ich bin nicht zum Jazzer geboren – ich spiele einfach auch Jazz. Mein Bruder und ich sind, was die Musik betrifft, polystilistisch aufgewachsen. Mit Komponieren fing ich sehr spät an, denn davor hatte ich grosse Hemmungen. Während des Studiums in Basel las man bisweilen hochkomplexe Analysen von Werken, wobei sich bei mir dann beim Hören oft Enttäuschung einstellte. So wuchs in mir die Überzeugung, dass ich meiner Sache schon sehr sicher sein müsste, bevor ich musikalische Gedanken zu notieren beginne. Eines Tages trat der Kunstmaler Müller-Brittnau mit dem Wunsch an mich heran, er möchte von mir Musik haben für eine seiner Ausstellungen. In der Folge entstand das Stück Don’t be Afraid of Colours für Streichorchester. Ich spielte dann in einem Tonstudio die Stimmen via Keyboard ein und das Ganze lief während der Ausstellung ab CD. Der Sohn des Kunstmalers war (und ist) Pianist beim Ensemble für Neue Musik Zürich. Als er diese Musik hörte, resultierte daraus mein erster Auftrag für dieses Ensemble. Obwohl das Stück so etwas wie «gedehntes cis-Moll» war, hatte ihn etwas daran anscheinend angesprochen. Seither mache ich pro Jahr im Schnitt eine Auftragsarbeit – leider lässt mein langsames Arbeitstempo nicht mehr zu …
In welchem Verhältnis stehen die beiden musikalischen Tätigkeiten? Gibt es eine Wechselwirkung zwischen spontaner Improvisation und Deiner spekulativen, fast grüblerischen Art zu komponieren?
Einer Wechselwirkung zwischen Kompositions- und Improvisationstätigkeit bin ich mir eigentlich nicht bewusst. Wenn ich als Improvisator eine Idee habe, spiele ich sie. Als Komponist lege ich sie auf den Prüfstein, klopfe sie auf ihre Herkunft und auf ihr Entwicklungspotential ab, «lade sie strukturell auf», forme sie um, leite ab – kurzum: ich komponiere. Irgendwie sind das zwei verschiedene Sprachen für mich, mit je ihren spezifischen Stärken. Plakativ formuliert, könnten diese heissen: die Stärken des Moments und der (Re-)Aktion gegen die Stärken der Planbarkeit und der Reflexion. Um beim Sprach-Vergleich zu bleiben: Es gibt vermutlich gute Gründe dafür, dass sich die «Crossover-Sprache» Esperanto nicht durchgesetzt hat.