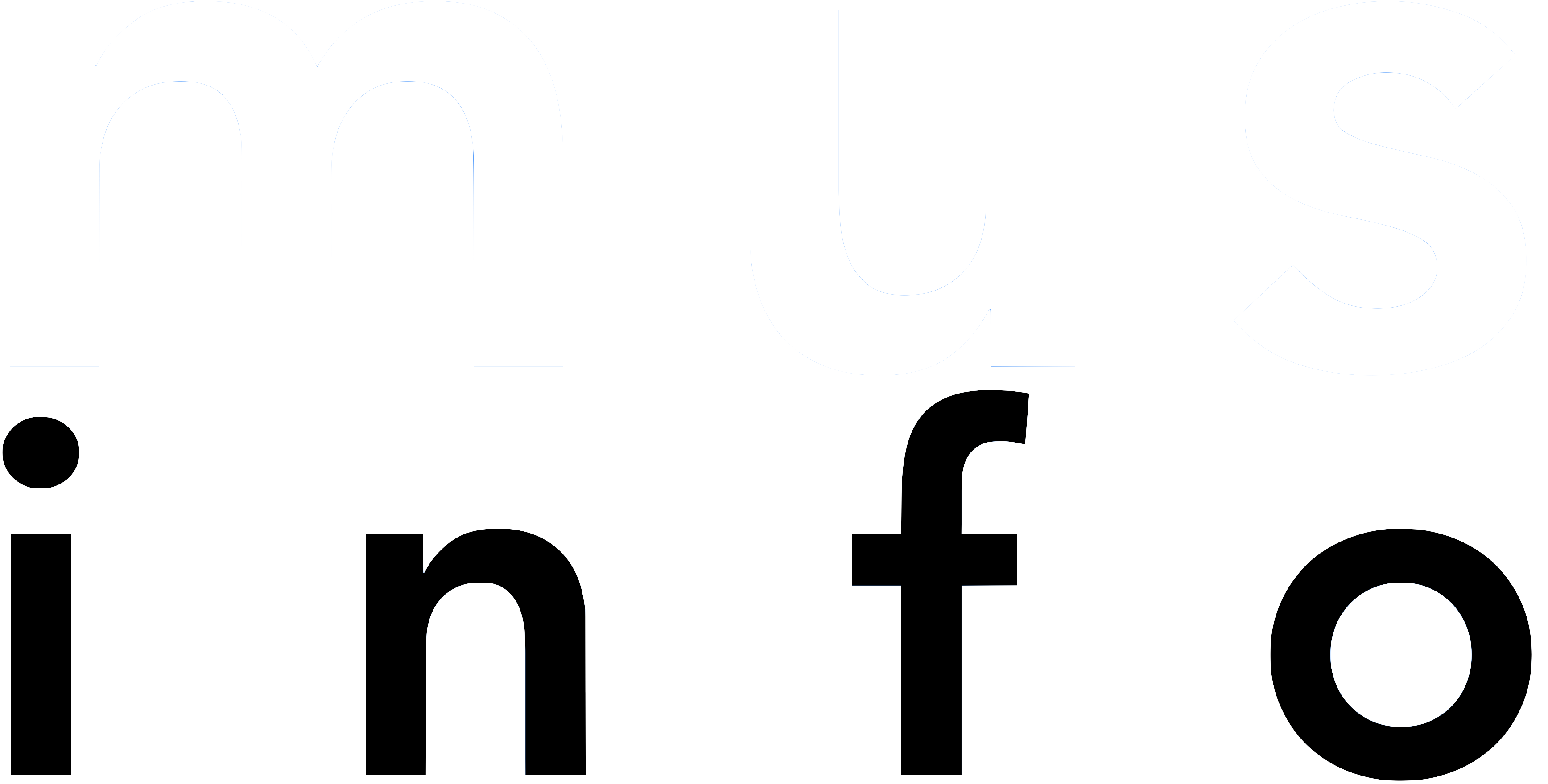Theo Hirsbrunner
(1931–2010)

Ganz unerwartet, zum letzten Mal, sah ich Theo Hirsbrunner im September beim Tonkünstlerfest in Luzern, nach der Preisverleihung an den abwesenden Franz Furrer-Münch. Dabei kam es zu einem längeren, schönen Gespräch. Aber frühe Erinnerungen, etwa an sein Streichtrio, das ich vor über fünfzig Jahren in einem Konzert der Veress-Klasse gehört hatte, interessierten ihn nicht. Er winkte ab, mit einem Lächeln: «Warum fragt man mich immer wieder nach diesem Stück? Das ist vorbei. Viel zu viele Dissonanzen. Damit habe ich nichts mehr zu tun.» Auf seine Vorträge an der Berner Volkshochschule angesprochen, mit denen er mir um 1960 Welten (Wiener Schule, Boulez) eröffnet hatte, meinte er nur: «Die wurden bald abgesagt, weil es an Anmeldungen fehlte.» Nach Paris befragt, wo er studiert, geforscht und später am IRCAM unterrichtet hatte: «Was soll ich jetzt dort? Grisey ist gestorben, Murail in Amerika.» An der Gegenwart freilich war er interessiert. Er freute sich auf die Zürcher Uraufführung von Dalbavies Gesualdo-Oper, er schrieb Artikel über die Musik junger Komponisten, so – den vielleicht letzten – zu Stefan Wirth (dissonance 112, S. 30 –35), und war, trotz körperlicher Beschwerden, die er mit keinem Wort erwähnte, gerade dabei, sich am Tonkünstlerfest über die neusten Schweizer Produktionen zu informieren.
1931 in Thun geboren, studierte Theo Hirsbrunner zunächst Violine: in Bern beim legendären Walter Kägi, der auch die Volkssinfoniekonzerte dirigierte, und bei René Benedetti in Paris. Nach 1956 folgten Kompositionsstudien bei Sándor Veress in Bern und in Ascona bei Wladimir Vogel, der, ausserhalb von Institutionen unterrichtend, damals innerhalb der Schweiz als der einzige Gewährsmann für Zwölftontechnik galt. (Auch Robert Suter und Jacques Wildberger studierten bei ihm.) Als Paul Sacher 1960 Pierre Boulez nach Basel berief, wurde auch Hirsbrunner Mitglied dieser berühmten Klasse, zu der unter anderen Gilbert Amy, Heinz Holliger, Hans Ulrich Lehmann, Jacques Guyonnet und Pierre Mariétan gehörten.
Am Berner Konservatorium unterrichtete Theo Hirsbrunner bis 1987 Musiktheorie (sowohl als Pflicht- wie als Hauptfach), Werkanalyse und neuere Musikgeschichte. Ungezählte Musikerinnen und Musiker haben bei ihm einen fundierten, aber unakademischen, stets an der lebendigen Musik orientierten Unterricht erhalten. In der Regel sass man beim Klavier. Beispiele aus der Literatur spielte er dank seines fabelhaften Gedächtnisses meistens spontan auswendig. Als mein Hauptfachlehrer Veress im Ausland weilte, durfte ich mich mit Hirsbrunners sehr kompetenter Hilfe auf mein Theorie-Lehrdiplom vorbereiten. Was ich bei der Arbeit mit ihm am meisten schätzte, war die «Welthaltigkeit» in seinem Blick auf die Musik. Er war nicht nur ihr hervorragender Analytiker, sondern ebenso ein Kenner des Umfelds, aus dem sie gewachsen ist. Dies ist vielleicht auch der grösste Reiz seiner Bücher und vieler Artikel, die er im Folgenden publiziert hat.
Zunehmend verlagerte sich Hirsbrunners Interesse vom Unterrichten hin zu Forschung und Musikschriftstellerei. Obschon er nie Musikwissenschaft studiert hatte, galt er bald als weltweit anerkannte Instanz besonders auf dem Gebiet der neueren französischen Musik. In längeren Zeitperioden bereitete er sich in den siebziger Jahren in der Pariser Bibliothèque Nationale auf seine Buch-Publikationen vor, die dann in den achtziger Jahren in rascher Folge im Laaber-Verlag erscheinen konnten: Debussy und seine Zeit (1981), Igor Strawinsky in Paris (1982), Pierre Boulez und sein Werk (1985), Olivier Messiaen. Leben und Werk (1988), Maurice Ravel. Sein Leben. Sein Werk (1989). Diesen fünf monographischen Arbeiten folgte 1995 der Überblick Die Musik in Frankreich im 20. Jahrhundert. In den neunziger Jahren öffnete sich das Spektrum vor allem geographisch und zeitlich. Einen besonderen Schwerpunkt bildete nun das Musiktheater seit dem 19. Jahrhundert, etwa im Essayband Von Richard Wagner bis Pierre Boulez (1997). Wagner kommt nun immer wieder zur Sprache, nicht nur in Beziehung zur starken französischen Rezeption.
Theo Hirsbrunner hat für seine publizistische Tätigkeit, die verbunden war mit vielen Reisen und Referaten in ganz Europa und Übersee, auch zahlreiche Ehrungen erhalten. Erwähnt sei hier die ihm 1996 von der Universität Bern verliehene Ehrendoktorwürde. Sie dürfte ihn gefreut und auch ein bisschen amüsiert haben, da er, wie man sich erzählt, ein bisschen stolz darauf war, nie ein Diplom erhalten zu haben. Und 1998 ernannte ihn der französische Kultusminister zum Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
An die fünfzig Titel mittleren und kleineren Umfangs zählt die Bibliographie aus den letzten zwölf Jahren (www.musinfo.ch). Besonders erwähnt seien mehrere Studien zur Musik der Kreise um die französischen «Spektralisten», mit denen Hirsbrunner zum Teil auch persönlich in engem Kontakt stand. Als kritischer Geist stand er freilich allen Schubladen-Begriffen skeptisch bis ablehnend gegenüber. Das hatte er schon beim sogenannten «Serialismus» so gehalten, den er ja «von innen» kennen musste. Da er mit etlichen der besten Exponenten solcher vermeintlicher «Schulen» vertraut war, konnte er sie beim Differenzieren und Hinterfragen bequemer Begriffe unterstützen, soweit das gegen eine Schablonen-Rezeption überhaupt möglich ist.
Polemik, die er in früheren Jahren vor allem im mündlichen Verkehr keineswegs gescheut hatte, war seinem Schreiben fremd. Es war sichtlich an musikalischen Techniken geschult, differenzierend zwischen Thema und Motiv, durchführend und assoziativ verknüpfend. Sein Debussy hat «in der Stille eine Revolution vorbereitet, die Musik des Schweigens nämlich, ohne die die heutige Musik nicht mehr denkbar wäre.» Dieser am Ende des Vorworts überraschend hingestellte Satz wird im letzten Kapitel subtil eingelöst. Versteckt, am Ende des Vorwortes zu seinem Ravel, finden wir sogar ein Wort zur eigenen Person, was er sonst konsequent vermeidet und sich hier auch bloss in der dritten Person erlaubt, abwägend und – so charakteristisch für ihn – zur Relativierung einladend: «Auch das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Musik und Wesensart wird dargestellt. Man möge aber hier eine einzelne Meinung nicht überbewerten, sondern sie vielmehr ins Ganze einordnen und deshalb auch relativieren. Das Schwanken zwischen den beiden Polen, dem deutschen und französischen, wurde dem Autor dieses Buches, der Schweizer ist, zur Gewohnheit, da er nicht weit von der Grenze zwischen den beiden Sprachen lebt.»