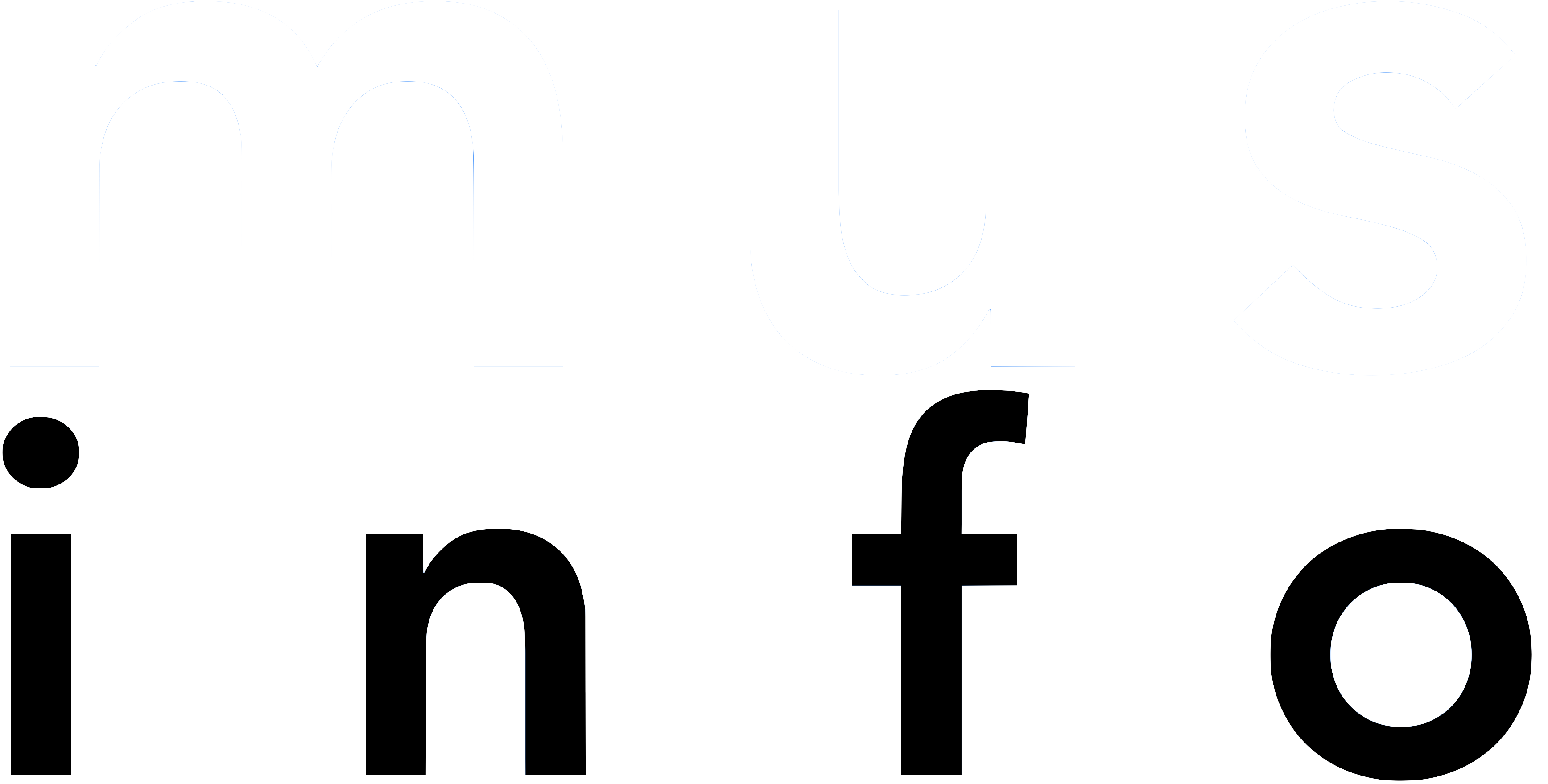(z)eidgenössisCH
Das 110. Tonkünstlerfest als Teil des Lucerne Festivals
(11.-12.9.2010)
Wie der Bergsteiger will sich der Festivalbesucher orientieren. Mit Uhr und einer Wanderkarte in Form des Programmbuchs macht sich der eifrige, manchmal auch erschöpfte Hörer auf den Weg, macht sich so (s)ein Bild von einer Szene oder gleich von der musikalischen Topographie eines ganzen Landes. Es ist legitim, in Luzern nach der Spezifik der Schweizer Szene zu fragen, denn schliesslich handelt es sich beim alljährlichen Tonkünstlerfest um die Nabelschau Schweizer Komponisten. Bunt ging es dabei zu, Generationen und Gattungen übergreifend: Ein Orchesterwerk des jungen Martin Jaggi (geb. 1978) war zu hören, ein Chorwerk des mit dem Marguerite Staehelin Kompositionspreis ausgezeichneten Altmeisters Franz Furrer-Münch (1924-2010) [Anm. der Red.: Franz Furrer-Münch ist wenige Wochen nach dem Tonkünstlerfest verstorben], ein Stück für Flöte solo von Oscar Bianchi (geb. 1975), viele Ensemblewerke unter anderem von der Zürcherin Cécile Marti (geb. 1973) sowie eine «musikalisch-szenische Erzählung» namens Marsyas gegen Apoll von Jürg Wyttenbach (geb. 1935).
Zur Komposition gesellte sich die Improvisation unter anderem mit Alfred Zimmerlin, Fritz Hauser und Michael Wertmüller – Kritikern, die dem Tonkünstlerverein eine eher rückständige ästhetische Position unterstellen, konnten sich in diesem Jahr über mangelnde Progressivität oder Experimentierlust nicht beschweren. Allerdings: So klar war es in diesem Jahr nicht, wer das Tonkünstlerfest eigentlich ausrichtete. Zur engen Zusammenarbeit des Vereins mit der Stiftung Pro Helvetia gesellte sich diesmal das Lucerne Festival. Es stellte nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern übernahm gleich auch die Finanzierung von neun der insgesamt 24 Uraufführungen. Dass sich in diesem Jahr ein wirkungsmächtiger Partner fand, ist angesichts der vielen allzu intimen Konzerte des letzten Jahres in Lausanne erfreulich. Andererseits neigen Global Players gerne dazu, kleine nationale Unternehmen zu schlucken. «Eros», das diesjährige Motto des Lucerne Festivals, zierte (wie immer wenig inhaltlich begründet) die verbale Wanderkarte des Tonkünstlerfests – der Schweizerische Tonkünstlerverein (STV) als (Mit-)Ausrichter dieser Tour blieb für die öffentliche Wahrnehmung jedenfalls eher im Hintergrund.
Es müssen nicht immer Gipfel, es können auch Gipfeli sein. Unbedingte Meisterwerke entdecken zu wollen, ist ein problematischer, wenn nicht gar falscher Anspruch bei einem Uraufführungsfestival. Ein im Partiturbild beeindruckendes Werk kann bei seiner Erstaufführung schon mal enttäuschen. Die viel diskutierte Uraufführung von Michael Wertmüllers monströser Zeitkugel für Klavier/Orgel und Orchester weckt Erinnerungen an skandalumwitterte Aufführungen der Vergangenheit. Bernd Alois Zimmermanns Konzept einer «Kugelgestalt der Zeit» habe ihn inspiriert, sagt der 1966 geborene Wertmüller. Die Überlagerung verschiedener Zeitschichten ist das erwartete Resultat – eines, mit dem es die basel sinfonietta und auch der Hörer nicht leicht hat. Vollgriffig die Einleitungspassage des unermüdlichen Dominik Blum am Flügel, danach folgt eine überbordende Komplexität, die selbst fünf Dirigenten nicht zu domestizieren vermögen und die selbst unter luxuriösesten Probenbedingungen kaum zu beherrschen wäre. Nach einem halbstündigen Dröhnen bleibt es beim Eindruck eines neuzeitlichen «Maximalisten» (Richard Taruskin), der sich ganz der Radikalität verschrieben hat, letztlich aber auch gut daran täte, sein Konzept durchaus im Sinne gezielterer Wirkungsmacht zu überdenken. Dafür wird ihm von der basel sinfonietta nun Gelegenheit gegeben: Nach einer Revision, heisst es, könne Zeitkugel in der nächsten Saison nochmals uraufgeführt werden. Gleichzeitig bleibt ein schaler Nachgeschmack angesichts der Tatsache, dass just jenes Orchester, das sich erklärtermassen unermüdlich dem musikalisch Neuen und Experimentellen verschreibt, eine extreme und besonders anstrengende zeitgenössische Klangform gleich nach der Uraufführung absetzt. [Anm. der Red.: Vgl. hierzu die Stellungnahmen von Wertmüller und Blum]
Martin Jaggi macht es weit besser. Sein Moloch für grosses Orchester (2008), bezeichnenderweise keine Uraufführung, besticht titelgemäss durch raue Klanglichkeit, gravitätische Schwere und ausgeprägten Sinn für eine organische Verbindung heterogener Materialien. Wie Jaggi schlüssig von seinen in der Tiefe reibenden und knarzenden Klängen zu am Ende wunderbar irisierenden Wirkungen kommt, bleibt bis auf weiteres sein Geheimnis (und ist letztlich wohl nur näherungsweise durch seine Anlehnung an Prinzipien arabischer Musik zu erklären). Moloch jedenfalls zählt wie Cécile Martis erfrischendes AdoRatio für Violine und Ensemble – weit entfernt von einem bloss klangschmucken Stück, zu hören mit der famosen Bettina Boller und dem verlässlichen Collegium Novum Zürich – zu den Werken, die von einer jüngeren helvetischen Generation einiges erhoffen lassen.
Wie steht es nun mit der Spezifik einer Schweizer Szene? Pauschalisierungen führen ins Leere. Nicht nur in der Schweiz ist Neue Musik verwirrend vielfältig, was ein Nationen-Denken vor gewisse Herausforderungen stellt. Ob sich das «Misstrauen gegenüber internationalen Strömungen» (Roman Brotbeck im Programmheft) tatsächlich schlüssig begründen lässt oder ob die These haltbar ist, dass sich in der Post-Feldman’schen Musik «ein besonderer helvetischer Charakterzug zu spiegeln vermag» (Thomas Meyer, ebenfalls im Programmheft), wäre vielleicht eine vertiefende Diskussion wert. Eigenbrötlerei jedenfalls kann sich auch als unangemessene Form des Rückzugs erweisen. Helena Winkelmans Adaption der Schweizer Volksmusik ist mehr ein Fall für die Glokalisierungs-Forschung der Soziologie. In ihren Drei Schaffhauser Tänzen – nach traditionellen Melodien aus der Volksmusiksammlung Hanny Christen – wollte sie die urtümlichen Strukturen in Schieflage bringen, Elemente aus der zeitgenössischen Musik und der Welt des Techno «auf die Hörner nehmen». Was bleibt, sind recht belanglose und kokette Stückchen ohne besonders interessante Fragestellungen. Urban Mäders Über Stock und Stein. Begegnungen auf der Alp und Fabian Müllers Maden, Motten und das Muotathal für «Alpini Vernähmlassig» zeigen zumindest stellenweise etwas mehr an Eigenständigkeit und Witz, können aber auch nicht über ein – sowohl durch das Sujet wie durch die interpretatorische Qualität bedingt – äusserst dürftiges Konzert hinwegtäuschen. Vollends desaströs erscheint Hanspeter Kyburz’ anspruchsvolle, sehr dichte und variantenreiche Danse aveugle (1996/97) in der Präsentation des Ensemble HELIX, einer Formation des Studios für zeitgenössische Musik der Hochschule Luzern. Eine machbarere Aufgabe hätte man sich für die gut gedachte Integration junger Studierender gewünscht.
Bekanntermassen reich und weit über die Landesgrenzen bekannt ist die gegenwärtig wunderbar diskursfreudige Schweizer Freie Improvisationsszene. Erstaunlich deutlich wird in Luzern eine – in den komponierten Werken kaum auffallende – Geräuschlastigkeit und Denaturierung des instrumentalen Tons. Kleinteilig agiert Alfred Zimmerlin am Cello zusammen mit dem Perkussionisten Fritz Hauser. Auf einem Tisch hat Hauser allerhand Materialien ausgebreitet und bearbeitet sie stellenweise in autistischer Hektik und ohne auf die teils bedächtigeren Töne Zimmerlins einzugehen. Eine weniger sophistische Interaktion pflegt ein Quartett mit Dieter Ammann (Klavier), Christy Doran (E-Gitarre) und den Schlagzeugern Fredy Studer und Michael Wertmüller. Lustvoll, oft in geraden, vorwärts treibenden Beats finden die «alten Hasen» zusammen, die arg trocken klingende Halle des Südpols erfüllen sie lautstark mit Leben – wie später Ammann mit seiner schon fast legendären Groove- und Free Funk-Formation Donkey Kong’s Multiscream den Club im Keller des Südpols.
Alfred Zimmerlin, seines Zeichens Komponist und Improvisator, ist bei diesem Tonkünstlerfest oft vertreten. Zu einem Mythos in sieben Bildern namens Herzmaere schrieb er sogenannte Herzstücke. Stilsicher sind die kurzen, apart komprimierten Geigen-Interpolationen verankert in einem reduzierten Bühnengeschehen, das karg ausfällt und den Geist der altertümlichen Texte von Gottfried von Strassburg und Konrad von Würzburg erfasst. Drei Interpreten, die famose Susanne Zapf als Isolde, Florian Volkmann als Tristan sowie Pascal Viglino als König Marke, deklamieren die Texte, begleitet von Gongs und perkussiven Improvisationen. Hinzu kommen so genannte Video-Fresken und eben die von Susanne Zapf gespielten Herzstücke, in die das ebenso sehnsüchtige wie liebesgetränkte Geschehen in Anlehnung an die Figur Tristans sogartig zu münden scheint.
Wie jedes Jahr, so fällt auch heuer ein Resümee des Tonkünstlerfests schwer. Zu begrüssen ist die Einbindung von Studierenden sowie die stilistische Öffnung des Festivals. Auch die Zusammenarbeit mit einem «Partnerfestival» ist prinzipiell lobenswert und wird mit eclatsconcerts Fribourg im Jahr 2011 und auch dem Genfer Festival Archipel 2012 fortgesetzt. Defizite machten sich in der Programmierung breit. Anna Spinas Programm «trois femmes – quatre sens» bewegte sich sowohl werkimmanent als auch interpretatorisch weit unter vertretbarem Niveau. Sorgen muss man sich generell um die Interpretationsstandards in der Schweizer Musiklandschaft. Während herausragende Solisten durchaus zu finden sind, zeigte sich in den Konzerten des Collegium Novum Zürich oder der basel sinfonietta, dass grössere helvetische Ensembles oder Orchester nicht einmal annäherungsweise mit der europäischen Spitze konkurrieren können. Wenn 24 Uraufführungen möglich sind und eine reichhaltige Stiftungslandschaft auch fernab des Tonkünstlerfests für nicht wenige Kompositionsaufträge sorgt, so sollte eine Hebung des Interpretationsstandards etwa durch gezielte Förderung von Ensembleprojekten in Angriff genommen werden. Die gerade in den letzten Jahren enorm verbesserte Ausbildungssituation punkto Neuer Musik an Schweizer Musikhochschulen wäre hierfür eine Steilvorlage.